PDA: Derzeitiges Verständnis und zukünftige Forschungsrichtungen
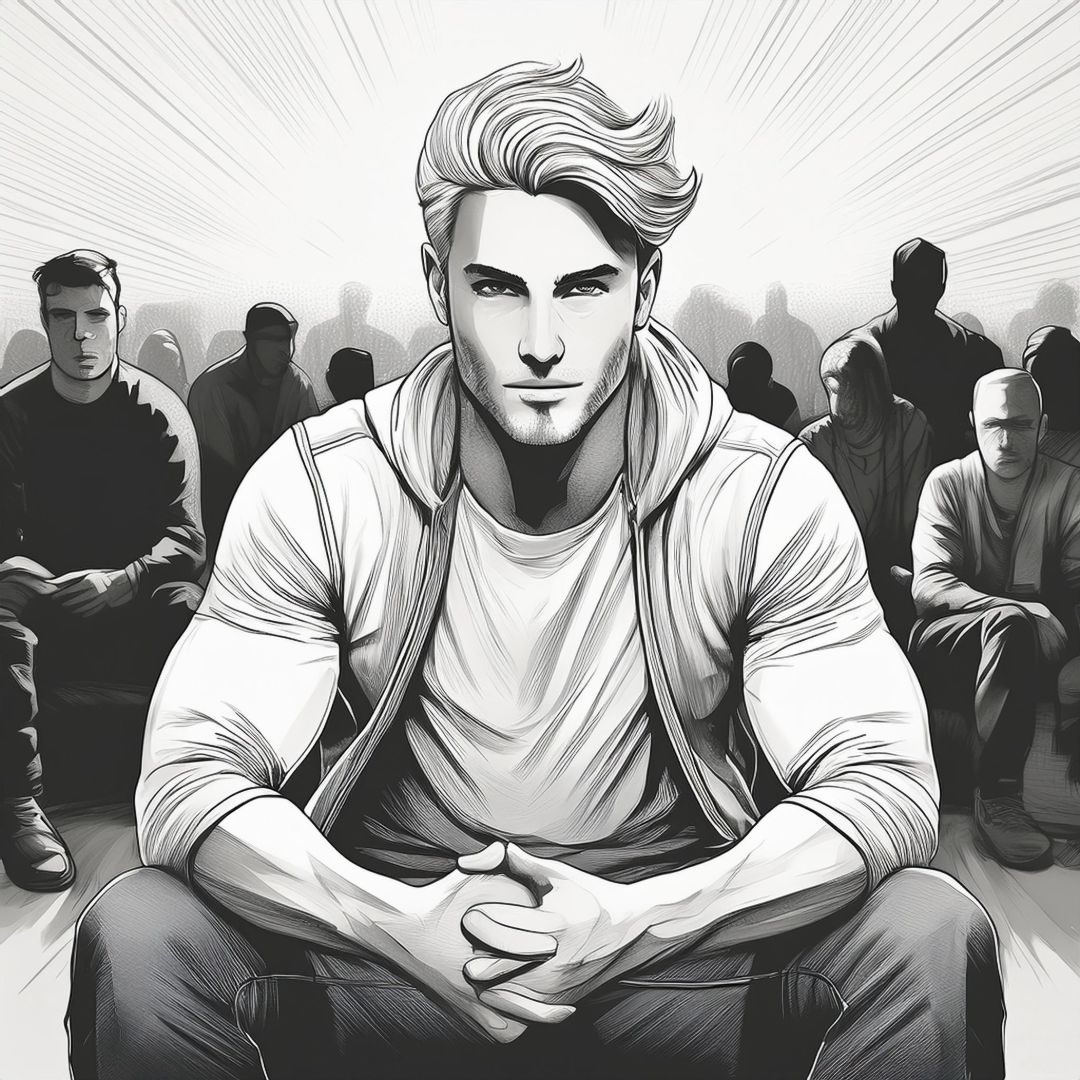
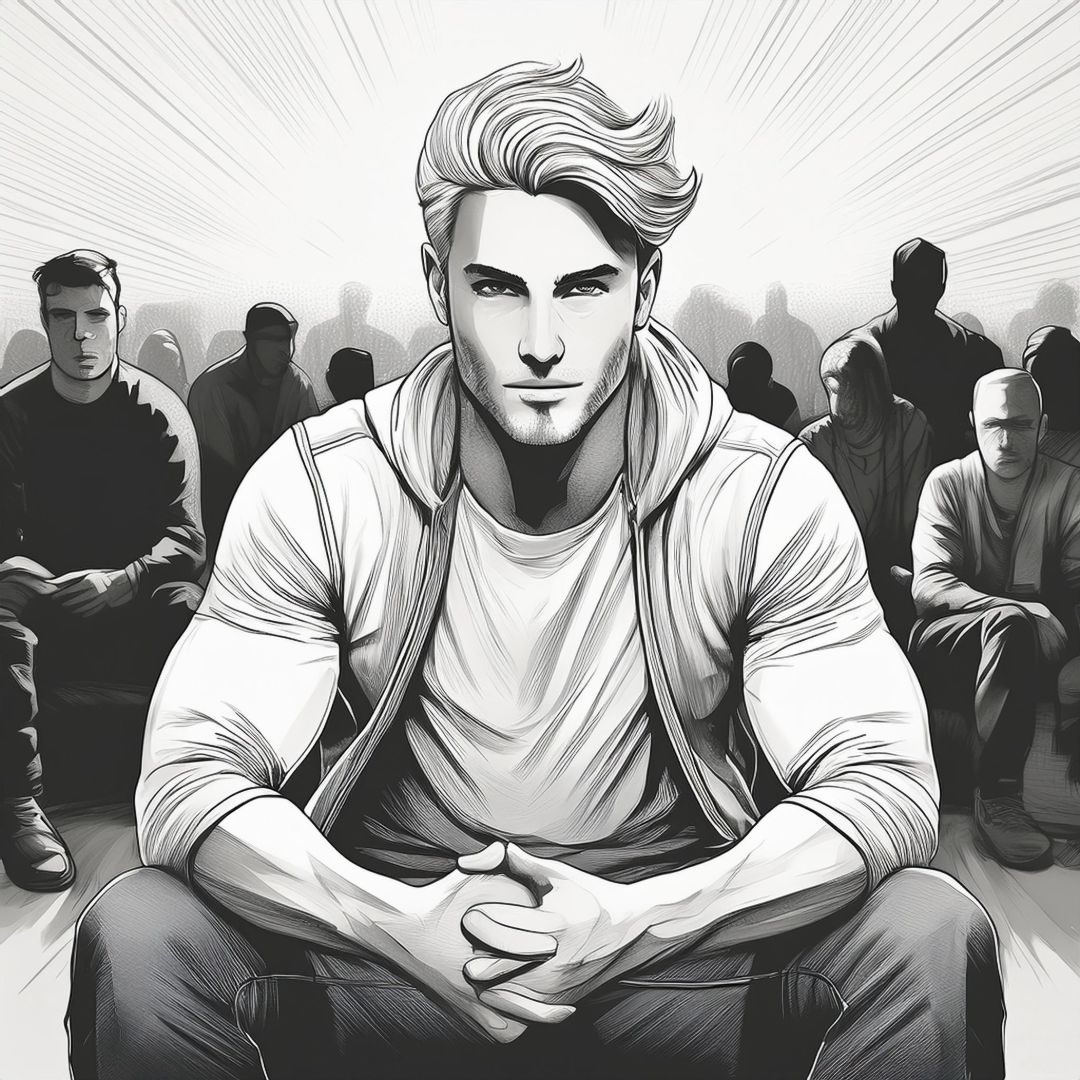
Von Dr. Michelle Garnett und Prof. Tony Attwood – Übersetzung: Saskia Paasch für Fachverein PDA Deutschland
PDA-Verhalten kann von außen sehr widersprüchlich erscheinen. Plötzlich vermeidet eine Person hartnäckig und wie besessen Alltagsaufgaben, die sie an den Tagen zuvor scheinbar mühelos erledigen konnte, zu denen sie also in der Lage ist und die zumindest keine offensichtlichen angstauslösenden Faktoren beinhalten. Für alle Beteiligten, inklusive der Person mit PDA selbst, wäre es einfacher, wenn diese Aufgaben einfach erledigt würden. Teilweise handelt es sich bei den vermiedenen Tätigkeiten sogar um Dinge, die die Person selbst mag oder bei denen sie selbst die Notwendigkeit sieht, sie zu verrichten. Weshalb geht sie diesen Aufgaben also nicht einfach nach? In diesem Artikel soll das derzeitige Verständnis zum Auftreten von PDA beleuchtet werden. Außerdem skizziert Tony Attwood zukünftige Forschungsrichtungen, die eingeschlagen werden müssen, um den Wissensstand zu diesem speziellen Autismusprofil zu erweitern.
PDA und Ängste
Kildahl et al. (2012) untersuchten 13 ausgewählte, ihre Einschlusskriterien erfüllende Studien zum Thema „PDA bei Kindern“, um diese auf ihre methodische Genauigkeit zu überprüfen. Einer der Forschungsgegenstände, denen sie sich widmeten, war der Zusammenhang von PDA und Angstzuständen. Diese Fragestellung ist äußerst wichtig, da Vermeidungsverhalten im Allgemeinen im Zusammenhang mit einem hohen Maß an Angst auftritt, und Angst bei Autismus weit verbreitet ist (Kerns et al., 2020). Nur zwei der acht untersuchten Querschnittsstudien legten den Fokus auf Ängste, und in beiden Studien wurde festgestellt, dass die PDA-Gruppe mit einem stärkeren Angstniveau korrelierte als die Autismusgruppe (ohne PDA, Anm. d. Übers.) (O’Nion’s, Viding et al., 2014; Stuart et al., 2020).
Eine Studie (Gore Langton & Frederickson, 2016) befragte Eltern von PDA-Kindern und deckte dabei Thematiken auf, die sich sowohl auf das Sicherheitsbedürfnis als auch auf bestimmte Reaktionen der Kinder auf Unsicherheit/unsichere Situationen bezogen. Nur in einer der drei in die Überprüfung einbezogenen Fallstudien wurden mögliche psychiatrische Begleiterkrankungen betrachtet (Reilly et al., 2014). Von den vier darin untersuchten Kindern im Alter zwischen 5 und 10 Jahren erfüllte keines die Kriterien für Angsterkrankungen/Angststörungen oder Depressionen. Ängste können sich allerdings bei autistischen Kindern anders als bei nicht-autistischen zeigen, weshalb es durchaus möglich ist, dass die Eltern die Anzeichen dafür übersehen haben.
Derzeit gibt es nur wenige Studien, die das Zusammenspiel von PDA und Angst oder Trauma untersuchen. In jeder der von Kildahl und seinem Team untersuchten Studie, verließ man sich auf Informationen der Eltern. In keiner wurden die Personen mit PDA selbst zu ihren Ängsten befragt. Es ist auch dadurch ein schwieriges Studiengebiet, da sich die Ängste von autistischen Kindern anders zeigen als die von nicht-autistischen und sie zusätzlich durch Interozeption, also der Wahrnehmung des Körpers, und/oder Alexithymie – Gefühlsblindheit – oder Sprachprobleme seltener in der Lage dazu sind, selbst über ihre Ängste zu berichten.
Bei der Konzeptualisierung von PDA als eigenständige Diagnose/Erkrankung sollte vernünftigerweise darauf verzichtet werden, das Profil durch andere Diagnosen/Erkrankungen wie Angststörung und/oder Depression und/oder traumabedingte Störungen zu erklären. Bei diesen Erkrankungen kommt es ebenfalls zu einem pathologischen (oder dysfunktionalen) Ausmaß an Vermeidungsverhalten. Eine Sorge, die von Forschenden geäußert wurde, ist, dass die Gefahr besteht, dass eventuell zugrunde liegende emotionale Schwierigkeiten wie Angststörungen oder Trauma, nicht hinreichend thematisiert oder behandelt werden, wenn PDA als neurologische Erklärung für bestimmte Verhaltensweisen herangezogen wird (Orm et al., 2019).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es, wie oben erwähnt, einen eindeutigen Zusammenhang zwischen PDA und Angst gibt, dieser jedoch noch nicht vollständig erforscht und verstanden ist. Die derzeitige klinische Konzeptionalisierung (z. B. Christie & Fidler, 2018) sieht die Angst als Auslöser der Unfähigkeit, tägliche Anforderungen zu erfüllen, d. h., die Anforderungsvermeidung entsteht durch das Bedürfnis, die Kontrolle darüber zu haben, die übermannende Angst vor Kontrollverlust zu bewältigen. Eine Person mit PDA wird ihre Unfähigkeit als Erstarren (freeze) beschreiben. So sagte eine Frau kürzlich zu Michelle Garnett: „Mein Gehirn ist buchstäblich nicht dazu in der Lage. Ich suche mir das nicht aus. Ich kann es einfach nicht tun.“ Und eine Jugendliche, der Tränen der Verzweiflung die Wangen liefen, meinte kürzlich: „Ich verstehe nicht, warum ich normale Dinge, wie in die Schule zu gehen oder zu duschen oder die Hausarbeit zu erledigen, nicht wie jeder andere Mensch tun kann, aber ich kann es einfach nicht.“
Gene oder Erziehung
Bisher gibt es keine Forschungsarbeiten, die Anforderungsvermeidungsverhalten als komplexes soziales Phänomen untersuchen, indem sie die Wechselwirkung zwischen den Personen mit PDA und deren Umwelt mit einbeziehen. Nach unserem derzeitigen Verständnis von PDA liegen die Schwierigkeiten in der Person selbst begründet, wodurch der Einfluss des Umfelds verdeckt bleibt (Milton, 2013, Orn et al., 2019). Jede soziale Kommunikation findet jedoch aus einer Dynamik heraus statt, und diese Dynamik beeinflusst die Antworten einer jeden Person innerhalb dieser sozialen Interaktion. In transaktionalen Darstellungen von Autismus (Anm. d. Übers.: Darstellungen, in denen die Wechselbeziehungen mit dem Umfeld mit einbezogen werden) wird davon ausgegangen, dass der Entwicklungsprozess durch die Art der Reaktionen beeinflusst wird, die in der Interaktion mit anderen erfahren wird (Mitchell, 2017). Vielleicht liegt es an dem schrecklichen Irrtum der Psychiatrie, die Ursache von Autismus darin zu sehen, dass die Mutter ihr Kind nicht genug liebe (z. B. Bettelheim, 1967), dass es nur wenige Studien darüber gibt, wie sich die elterliche Erziehung und das familiäre Umfeld auf die soziale Entwicklung von autistischen Kindern auswirken. Wir wissen, dass Autismus nicht rein genetisch bedingt und ein Gehirn insbesondere in den ersten Jahren der Entwicklung stark formbar ist, was unweigerlich dazu führt, dass frühe soziale Erfahrungen die Gehirnentwicklung beeinflussen. Es wäre sowohl für autistische Menschen als auch deren Familien hilfreich, wenn es Untersuchungen dazu gäbe, welche elterlichen Erziehungsmethoden am geeignetsten dafür sind, autistische Familienmitglieder zu unterstützen.
Ein Beispiel für die Wechselbeziehung von Autismus ist das Konzept des „doppelten Empathie-Problems“ (Milton, 2012). Dieses besagt, dass autistische Menschen nicht nur deshalb Probleme damit haben, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, weil sie von Natur aus Schwierigkeiten damit haben, die Bedürfnisse bzw. Gemütsverfassungen nicht-autistischer Menschen zu deuten, sondern auch, weil eben diese anderen Menschen, Schwierigkeiten damit haben, die psychische Verfassung autistischer Menschen zu deuten. Es liegen also auf beiden Seiten Missverständnisse vor. Im Einklang mit diesem „doppelten Empathieproblem“ kann ein Kind mit PDA als ungezogenes, trotziges, unhöfliches und respektloses Kind fehlinterpretiert werden, weil es sich beharrlich weigert, vielen scheinbar nachvollziehbaren/vernünftigen/sinnvollen Aufforderungen von Erwachsenen nachzukommen. Infolgedessen kommt es häufig zu Disziplinarmaßnahmen, die bestenfalls aus einer ruhigen verbalen Korrektur und dem Entzug von Privilegien bestehen. An weniger optimalen Tagen kann es aber auch dazu kommen, dass die Eltern das Kind anschreien und sich über das Kind und sein Verhalten beschweren. Es können dann zum Beispiel Sätze fallen wie „Du musst in sozialer Hinsicht noch viel lernen“ oder „Warum machst du immer alles so schwierig?“, vielleicht sogar noch schlimmere. Sowohl die Eltern als auch das Kind haben dann das Gefühl, „nicht gut genug“ zu sein, und mit der Zeit kann sich ihre Beziehung verschlechtern.
Wenn davon ausgegangen wird, dass die Renitenz eines PDA-Kindes durch ein hohes Maß an Angst ausgelöst wird, welches wiederum dazu führt, dass das Kind entweder „erstarrt“ (freeze) oder „kämpft“ (fight) und dieses Kind durch PDA aufgrund von kognitiven Empathieproblemen keine Rücksicht auf die Auswirkungen seines Verhaltens auf die Familie oder die schulische Umgebung nehmen kann, wird die Angst des Kindes durch die beschriebenen typischen Erziehungsstrategien wahrscheinlich noch verstärkt. Es kann somit passieren, dass sich das Kind in der Familie weniger sicher fühlt, wenn es die Erziehungsmaßnahmen nicht nachvollziehen kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sie mit Schreien verbunden sind, da PDA-Kinder sehr sensibel sind und ein hohes Maß an affektiver Empathie besitzen, die dazu beiträgt, dass sie negative Energien sehr stark spüren. Viele Familien machen jahrelang solche Erfahrungen, bevor sie eine Diagnose erhalten und mehr Verständnis zu PDA erlangen. Dabei entsteht unbeabsichtigt großer Schaden in der Beziehung, der repariert werden muss.
Bei solchen Interaktionen kann die erlebte Fehlanpassung zu einem erhöhten Maß an Angst – sowohl bei den Eltern als auch beim Kind – führen, wodurch es möglicherweise zu mehr PDA-typischen Verhaltensweisen kommt, die als störend und sozial unangemessen angesehen werden und deshalb wiederum zu mehr negativen sozialen Sanktionen und Konsequenzen führen. Einige Forschende haben nahe gelegt, dass diese transaktionalen Faktoren PDA-Verhaltensweisen verschlimmern oder aufrechterhalten können (Davis & Crompton, 2021; Mitchell et al, 2021), es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass durch diese Erziehungspraktiken PDA verursacht wird. Selbst wenn von klein auf eine „sanftere“ Erziehungsmethode angewandt, d. h. der Erziehungsstil an die Bedürfnisse des Kindes angepasst wurde, und die Familie zum Zeitpunkt des Schuleintritts des Kindes gut funktioniert, zeigt sich die Intoleranz gegenüber Anforderungen deutlicher, sobald diese sich erhöhen (Sally Russell OBE, 2023, persönliche Mitteilung).
Forschungsrichtungen
Es gibt viele Bereiche, die weiter erforscht werden müssen, um PDA besser zu verstehen. Zu folgenden Themengebieten werden mehr Studien benötigt:
• Wie kann PDA zuverlässig festgestellt werden?
• Gibt es physische Marker für PDA, z. B. bei der Hirnstruktur?
• Welcher Zusammenhang besteht zwischen PDA und Angstzuständen?
• Welcher Zusammenhang besteht zwischen PDA und ADHS?
• Ist Angst ein Auslöser für Anforderungsvermeidung, und verringert die Behandlung der Angst die Anforderungsvermeidung?
• Gibt es Verhaltensmuster, die die Anforderungsvermeidung verstärken oder abschwächen, und wenn ja, welche?
• Welche Erziehungsmethoden sind für Kinder mit PDA am geeignetsten?
• Wie kann PDA bei Erwachsenen festgestellt werden?
• Wie können Erwachsene mit PDA am besten unterstützt werden?
Ressourcen
Es gibt viele gute Informationsquellen. Hier einige unserer Favoriten:
Anlaufstelle Information und Beratung: FAPDA (Fachverein PDA-Autismus-Profil) https://pda-autismus-verein.org/
Online-Information:
Die PDA Society im Vereinigten Königreich hat eine Bibliothek mit hilfreichen, evidenzbasierten Quellen zu PDA entwickelt. Wir empfehlen folgende:
PDA Society
Als Einstieg sehr empfehlenswert ist z. B. das Dokument Praxisleitfaden:
Practice Guidance Document
Der amerikanische Psychologe Dr. Ross Greene hat ein Betreuungsmodell namens Collaborative & Proactive Solutions (CPS, deutsch: Kooperative und Proaktive Lösungen) entwickelt, das sich auf Forschung und Praxis stützt und auf Zusammenarbeit und Mitgefühl beruht. Er verwendet nicht den Begriff PDA, sondern spricht stattdessen von Kindern, bei denen herausforderndes Verhalten auftritt, wenn die an sie gestellten Anforderungen und Erwartungen ihre Fähigkeit übersteigen, angepasst zu reagieren. Seine Website enthält ausgezeichnete praktische Ressourcen für Eltern, Lehrkräfte und Gesundheitsfachleute.
livesinthebalance.org
Bücher: Kinder und Jugendliche
Ein glücklicheres Leben für dein Kind mit PDA von Alice Running.
Collaborative Approaches to Learning for Pupils with PDA: Strategies for Education Professionals (2018) by Ruth Christie and Phil Fidler, published by Jessica Kingsley Publishers.
Super Shamlal – Living and Learning with Pathological Demand Avoidance (2019) by K I Al-Ghani, published by Jessica Kingsley Publishers.
Dr Ross Green (2021). The Explosive Child [Sixth Edition]: A New Approach for Understanding and Parenting Easily Frustrated, Chronically Inflexible Children. Published by Harper Collins, US.
Bücher: Erwachsene:
Zirkus im Kopf von Liv Cadler/Saskia S. Neu
Being Julia: A Personal Account of Living with PDA (2021). By Ruth Fidler and Julia Daunt. Published by Jessica Kingsley Publishers.
PDA by PDAers: From Anxiety to Avoidance and Masking to Meltdowns (2019). Ed. Sally Cat. Published by Jessica Kingsley Publishers.
PDA Paradox; The Highs and Lows of My Life on a Little Known Part of the Autism Spectrum. (2019). By Harry Thompson. Published by Jessica Kingsley Publishers.
Es gibt viele weitere tolle Bücher zum Thema PDA, die wir empfehlen können. Sie sind alle auf der Internetseite der PDA Society gelistet:
PDA Society Book List
Bibliografie
Bettelheim, Bruno. The Empty Fortress: Infantile Autism and the Birth of the Self. New York: Free Press, 1967.
Calvo F, Karras BT, Phillips R, Kimball AM, Wolf F. Diagnoses, syndromes, and diseases: a knowledge representation problem. AMIA Annu Symp Proc. 2003; 2003:802. PMID: 14728307; PMCID: PMC1480257.
Christie, R. & Fidler, F. (2018). Collaborative Approaches to Learning for Pupils with PDA: Strategies for Education Professionals. Jessica Kingsley Publishers, London, UK.
Eaton, J. & Weaver, K. (2020). An exploration of the Pathological (or Extreme) Demand Avoidant profile in children referred for an autism diagnostic assessment using data from ADOS-2 assessments and their developmental histories. GAP, 21 (2), 33- 51
Gillberg C. (2014). Commentary: PDA – Public display of affection or pathological demand avoidance? Reflections on O’Nions et al. (2014). (2014). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(7), 769–770. https://doi.org/10.1111/jcpp.12275
Gore Langton E., Frederickson N. (2018). Parents’ experiences of professionals’ involvement for children with extreme demand avoidance. International Journal of Developmental Disabilities, 64(1), 16–24. https://doi.org/10.1080/20473869.2016.1204743
Kerns C. M., Winder-Patel B., Iosif A. M., Nordahl C. W., Heath B., Solomon M., Amaral D. G. (2020). Clinically significant anxiety in children with autism spectrum disorder and varied intellectual functioning. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/15374416.2019.1703712
Kildahl, A. N., Helverschou, S. B., Rysstad, A. L., Wigaard, E., Hellerud, J. M., Ludvigsen, L. B., & Howlin, P. (2021). Pathological demand avoidance in children and adolescents: A systematic review. Autism, 25(8), 2162–2176. https://doi.org/10.1177/13623613211034382
Milton D. E. (2012). „Natures answer to over-conformity“: Deconstructing pathological demand avoidance. Autism Experts. https://kar.kent.ac.uk/62694/
Milton D. E. (2013). „Natures answer to over-conformity“: Deconstructing pathological demand avoidance. Autism Experts. https://kar.kent.ac.uk/62694/
Mitchell, P. (2017). Mindreading as a transactional process: Insights from autism. In V. Slaughter & M. Rosnay (Eds.), Environmental influences on ToM development, (pp. 157– 172). Hove, UKPsychology Press.
Newson E, Le Maréchal K, & David C. (2003). Pathological demand avoidance syndrome: a necessary distinction within the pervasive developmental disorders Archives of Disease in Childhood; 88:595-600.
Orm S., Løkke J. A., Løkke G. E. H. (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi [Pathological demand avoidance: A transactional behaviour analytic explanatory model without pathology]. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 46(1), 29–43. http://hdl.handle.net/11250/2619601
O’Nions E, Christie P, Gould J, Viding E, Happé F (2014) Development of the ‘Extreme Demand Avoidance Questionnaire’ (EDAQ): preliminary observations on a trait measure for pathological demand avoidance. J Child Psychol Psychiatry 55:758–768
O’Nions, E, · Gould, J, · Christie, P, · Gillberg, C. Viding E, & · Happé, F. (2016) Identifying features of ‘pathological demand avoidance’ using the Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders (DISCO), Eur Child Adolesc Psychiatry 25:407–419 DOI 10.1007/s00787-015-0740-2
Reilly C., Atkinson P., Menlove L., Gillberg C., O’Nions E., Happe F., Neville B. G. (2014). Pathological demand avoidance in a population-based cohort of children with epilepsy: Four case studies. Research in Developmental Disabilities, 35(12), 3236–3244. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.08.005
Sally Russell OBE (2023, personal communication). Chair of the PDA Society, UK.
Stuart L., Grahame V., Honey E., Freeston M. (2020). Intolerance of uncertainty and anxiety as explanatory frameworks for extreme demand avoidance in children and adolescents. Child and Adolescent Mental Health, 25(2), 59–67. https://doi.org/10.1111/camh.12336
Quelle:
Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Tony Attwood und Dr. Michelle Garnett: https://attwoodandgarnettevents.com/category/attwood-and-garnett-blog/